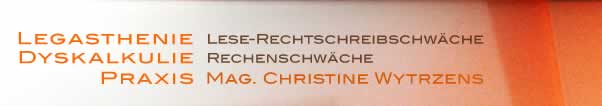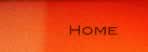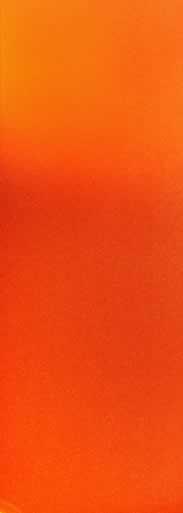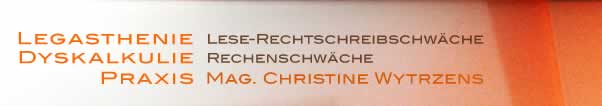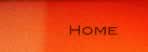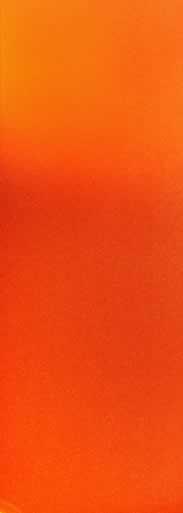Eine
„offene“ pädagogische Praxis, die um die Notwendigkeit sprachlicher
Normen und um die Spezifitäten von LegasthenikerInnen und den damit verbundenen
Schwächen beim Lesen, Schreiben und teilweise. Rechnen, aber auch um die
Stärken legasthener Menschen weiß, entwickelt „schulverträgliche“
Umgangsformen mit Dyslexie und Dyskalkulie und eröffnet den betroffenen
SchülerInnen und ihren betreuenden LehrerInnen adäquate Handlungsspielräume.
Eine wichtige, offizielle Anerkenntnis der Besonderheiten legasthener SchülerInnen,
auch auf schulrechtlicher Basis, die Erlassmüden vielleicht aufs Erste
nur eine mitleidige Reaktion in der Art „Papier ist geduldig“ entlocken
mag, sich aber bei genauerer Durchsicht als wichtiges entschärfendes, äußerst
hilfreiches Instrumentarium erweist, stellt der Wiener Legasthenieerlass aus
dem Jahr 1998 bzw. 2002 dar.
Was vorerst nur wie ein trockener Erlass aussieht, bringt klar den Auftrag zum
Ausdruck, legasthene Probleme bei der Leistungsbeurteilung zu berücksichtigen
und ergänzende legasthenieadäquate Formen der Leistungsfeststellung
abseits von schriftlichen Überprüfungen vorzusehen und durchzuführen.
Weiters betont der genannte Erlass die Aufgabe der Schule und Eltern, legasthene
Kinder bei der Ausbildung ihrer Lese- und Schreibkompetenz speziell zu fördern
und zu unterstützen.